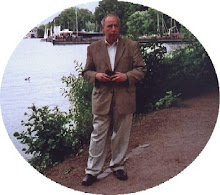Detaillierte Angaben für Autos und inzwischen auch für Häuser
Kommentar
November 2014.
(Dialog/jw). Wenn es um Energiefragen geht, ist man rege in der EU
und in einigen Ländern wie in Deutschland. Über Glühlampen und
vieles andere hinaus, geht es auch um Beschreibungspflichten wie
schon länger bei Autos und seit 1. Mai 2014 auch bei Gebäuden. Die
allgegenwärtige Bürokratie bürdet den Firmen und Bürgern immer
mehr Pflichten auf, wobei in diesen Fällen alles von den
Stichwörtern „CO2-Minderung“ und „geringerer Energieverbrauch“
umjackt ist, darüber der Mantel „Umwelt“.
Beim Auto: Es ist
noch hinzunehmen, dass in Prospekten und eventuell noch in
Werbeanzeigen die Verbrauchsdaten incl. CO2-Wert in Gramm pro
Kilometer für ein Beispiel-Modell angegeben sind. Wenn das dann noch in Pressemeldungen und
anderem passieren muss, in denen seitens des Herstellers oder
Importeurs in einem allgemeinen Kontext nur ein Fahrzeug
erwähnt wird, dann ist das schon eher merkwürdig. Ohnehin weiß
jeder, dass die nach EU-Vorgabe ermittelten Verbrauchswerte nur
theoretischen Wert haben, in der Praxis anders aussehen, ganz
abgesehen davon, dass jeder einen anderen Fahrstil hat. Zumindest
bieten die Theoriewerte – wie längst schon vor diesen
verpflichtenden Angaben – zumindest eine erste
Vergleichsmöglichkeit.
Bei Gebäuden: Da
begann das Dilemna bereits vor Jahren mit der Einführung des so
genannten „Energieausweises“. Der Verbrauchsausweis richtet sich
nach dem tatsächlichen Verbrauch an beispielsweise Öl oder Gas, der
weit aufwändigere und teurere Bedarfsausweis bezieht zahlreiche
Faktoren ein und soll daher „besser“ bzw. genauer sein. Das
ändert zweifellos nichts daran, ob, hier in Heizöl dargestellt, ein
Haushalt im Jahr 800 oder 1400 Liter verbraucht. Mal noch ist Heizen
individuell – wie das Autofahren. Vielleicht könnte den
Energiesparbeflissenen, „Agenturen“ und der EU auch einfallen,
die maximale Raumtemperatur für einzelne Räume festzulegen,
stichprobenartige Kontrollen eingeschlossen. Bei klassischen
Einraumöfen, in denen Festbrennstoffe verfeuert werden, gibt es das ja
schon. Auch hier steht für manche nach Ablauf der Karenzzeit Aufgabe
oder Änderungspflicht an. Kostet den Bürger auch wieder Geld.
Am schärfsten ist,
dass seit 1. Mai 2014 Energiekenndaten aus dem Energieausweis, soweit
vorhanden, auch in Vermietungs- und Verkaufsanzeigen genannt werden
müssen. Der Ausweis weist ja einen Punkt zwischen der Grün- und
Rotkennzeichnung aus. Anzugeben ist unter anderem auch der
Energieträger. Ist kein Witz, kann bei Zuwiderhandlung ab Mai
nächsten Jahres sogar als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Je
nach Gebäude – bei öffentlichen – schon länger, müssen die
Angaben über den Energieverbrauch sogar gebäudebezogen aushängen.
Wer bitte, schaut sich das an und wer interessiert sich - abgesehen
von einigen Freaks, die das wissen wollen – dafür und wozu soll es
dienen?
Alle Maßnahmen
bedingen zusätzliche Kosten für Firmen und Bürger. Der bezahlte
Anzeigenraum wird größer und damit teurer, der Energieausweis
kostet ebenfalls mehr als nur ein „paar Euro“. Aber die EU und
manche andere in Behörden damit Befasste haben zusätzliche
Aufgaben.
In diesem
Zusammenhang: Hausdämmungen von Fassade bis Dach, Materialien und
Fenster, Solaranlagen zur Warmwassererwärmung, die Einsparungen und
die Jahre bis zur Amortisation sind wieder ein anderes Thema.
Anscheinend denken
so einige, das Klima und den alle Jahrtausende, teils sogar alle
Jahrhunderte statftindenden Wandel des Welt- und Naturklimas
aufhalten oder ändern zu können.