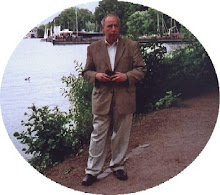Grau in Grau scheint die Welt für Alzheimer-Betroffene zu sein.
Alzheimer-Tag 21. September - immer ein Thema
Irgendwann holte es
auch den Vater ein
Von Jürgen Weller
September 2015. Er war Ende 60, als
uns auffiel, dass er sich an Orten, die er bis vor Kurzem jahrelang
besucht hatte, nicht mehr so richtig zurechtfand. Eduard* (*alle
Namen im Bericht geändert), Ehepartner, Vater und Opa, tat sich mit
der Orientierung schwerer und musste auch bei Menschen außerhalb des
wohnlichen Umfelds, die er Jahrzehnte lang kannte, öfter den Namen
nachfragen. Es dauerte noch rund ein Jahr, bis er auch in der Wohnung
nicht mehr bestimmt und geradlinig in die Zimmer ging. Mutter Erika
half ihm. Vater wusste aber noch, die Haustreppe zu gehen und wo sein
„angestammter“ Platz im Wohnzimmer auf der Couch war. Er war
fahrig und faltete die Tischedecke an seinem Platz hin und her, sonst
aber wirkte er zufrieden. Bis dahin funktionierte auch noch ein Teil
seines Kopfes, seines Gehirns. Fragten wir nach seinem Geburtsdatum,
kam es schnell: 13. Januar 1912. Aber die Krankheit, die Demenz, die
Hirnvergesslichkeit, heute meist „Morbus Alzheimer“, also
Alzheimer-Erkrankung, setzte sich durch. Keine medizinische Hilfe damals.
Als Eduard dem 70-Jährigen zuging, wurde klar, dass etwas mit seinem Gedächtnis nicht stimmte.
Er bemühte sich zwar, aber es wurde immer weniger. An seinem
Geburtstag erzählte er kaum etwas, obwohl er doch sonst gerne von alten
Zeiten und über die aktuelle Politik sprach. Ob er die Menschen noch
erkannte, die ihm zum Geburtstag gratulierten, wusste niemand zu
sagen. Er freute sich, schüttelte die Hand, sagte aber keine Namen.
Oft noch saßen wir zusammen neben dem Plattenschrank und legten Chöre, Märsche
und Walzer auf, die er auch nach dem 70. noch lange mitsummen konnte.
Wir fuhren gemeinsam in Urlaub an frühere Ferienorte, an der er sich
erinnern konnte, aber seine Worte wurden immer spärlicher. „Oh
Papa“, mussten wir, Mutter, Kinder, Enkel dann sagen, die wir den geistigen Verfall
miterlebten. Was hatte er für Geschichten, Erzählungen für seine
Heimatzeitung zum Westerwald geschrieben wie „Die Kräuter-Kathrin“
oder „Der Geist aus der Steineberger Höhe“, die noch in der
nächsten Generation bekannt waren. Wie kannte er als Postler die
deutschlandweiten Verbindungen der Bahnpost und die vielen Orte aus
dem Effeff, wie konnte er von seinen Kriegseinsätzen in
Griechenland, von Kreta und den Riesenschildkröten erzählen und von
den weiteren Wegen, wo ihm auch Menschen aus anderen Ländern,
eigentlich „Kriegsgegner“ weitergeholfen hätten. Alles das
verstummte mehr und mehr.
Zunehmender Verfall
Der normal gut große
und kräftige Mann verfiel mehr und mehr. Essen machte schon lange
keine Freude mehr. Aber er aß und trank wenigstens noch ein bisschen,
magerte dennoch immer mehr ab. Der Hausarzt versuchte es einmal mit
einer Spritze, die wohl die Hirndurchblutung oder sonstwas fördern
sollte. Wir wissen heute nicht mehr, was es war. Als er dann nach dem
Abholen aus dem Auto stieg, schien er verwirrter als zuvor zu sein.
Das hielt auch den nächsten Tag noch an. Kurz, es hatte nichts
gebracht! Eher im Gegenteil.
Irgendwann kam er
mit einer Art Bronchitis ins Krankenhaus. Seit seinen
Lazarett-Aufenthalten mit zig Splitter- und einer Einschussverwundung
während der Kriegszeit und mit nachgehender Behandlung war er nie
mehr in einem Krankenhaus. Nun aber stellten sie ihn dort „auf den
Kopf“, was er im Prinzip nicht gewollt hätte, aber nun nicht mehr
sagen konnte. Unser Bestreben dabei war, dass es ihm wieder besser ging. Man
diagnostizierte schließlich Wasser in der Lunge. Das wurde mit einer
Absaugspritze über den Rücken in die Lunge beseitigt. Atem- oder
Luftprobleme hatte er allerdings noch nie, auch keine Herzprobleme.
Nur wenige Jahre vorher hatte er noch lange Spaziergänge mit dem
Enkel und Erika gemacht. Die vier Treppen im Wohnhaus ging er teils
schneller als ich. In den letzten Monaten vor seinem Tod wollte er
aber zwischendurch eine Pause machen. Ein paar Sekunden, - tief
durchatmen.
Arztidee – Alkohol
und Vormundschaft
Als er in diesem Krankenhaus liegt, bittet uns der wohl leitende Arzt ins
„Chefzimmer“. Er erklärt uns: „Die Demenz scheint durch ein
Alkoholproblem bedingt zu sein“. Was? Das war für uns mehr als erstaunlich.
Wäre es nicht ernst gewesen: Es war zum Lachen. Deshalb klären wir
den Ober-Doc auch gleich auf. Wie in den wieder besser laufenden
Nachkriegsjahren bis in die 1960er-Jahre gab es alle paar Monate mal
eine Geburtstags- sowie einmal im Jahr eine Karnevals- und Silvesterfeier. Neben ein paar Bieren wurde
auch mal ein Schnaps, vorwiegend Wacholder, getrunken. Aber das
war's. Zu Hause trank Papa abends zum Wochenende mal gemütlich ein,
also ein!, Flaschenbier, und sonst nichts. Er ging auch nicht aus.
Ein einziges Mal im Leben habe ich meinen Vater nach einer großen
Feier mit Kollegen leicht betrunken gesehen. Sonst nie! In über 40
Jahren Ehe und über 30 Jahre täglichem Kontakt bekäme man das mit.
Oder? Schließlich war er nach der Arbeit oder später nach Spaziergängen oder Spielen mit den Enkel immer zu Hause. Kurz, es war nicht und nie so. Schlicht Unsinn, irgendwann
ausgedacht. Okay, zu der Zeit wusste man auch in Ärztekreisen vielleicht noch weniger über Alzheimer als heute. Wahrscheinlich war
Anfang der 1970er das Alzheimer-Problem noch nicht so richtig
durchgedrungen.
Der Arzt schockte uns aber erneut. Er eröffnete uns, dass er meinen Vater
nicht mehr als geschäftsfähig ansehen könnte und eine
Vormundschaft vorschlagen müsste. Jeder mag sich vorstellen, wie wir
reagiert haben. Es kam dann nicht dazu. Generell fragen wir uns, wie
es sein kann, dass in einer intakten Familie ein Vormund oder nach
dem nun seit Jahrzehnten neueren Recht ein fremder Betreuer bestellt
werden sollte?! Hat es sich da der Gesetzgeber einfach gemacht oder
wollte er nur einen neuen Begriff, Betreuer statt Vormund, einführen?
Unabhängig davon, dass so etwas in manchen Fällen vielleicht
notwendig ist, wissen wir heute um die nicht immer einfache sondern
teils problematische Abwicklung hinsichtlich Vermögensverwaltung und
Wohnbesitzbestimmung. Ein schwieriges Feld, bei dem Angehörige immer
genau schauen und wenn erforderlich Rechtswege ausschöpfen sollten!
Krankenhaus und
Altersheim
Zurück zum
Krankenaufenthalt. Vater fällt in eine Art Lethargie. Er isst und
trinkt wenig, nimmt zusehends weiter ab und ist kaum ansprechbar. Er ist nur noch "Haut und Knochen". Schlimm. Wir
wissen keinen Rat und rechnen mit dem Schlimmsten. Dann kommt eine
Visite. Einer der Ärzte sagt: „Der Mann ist ausgetrocknet“. Das
Problem kennen wir mittlerweile noch von manchen anderen Fällen aus nun
„ganz modernen“ Zeiten. Der Arzt ordnete an, was zu tun ist. Nun musste
man sich im Krankenhaus kümmern, und siehe da, der Demenz-Patient blühte im Rahmen
der Möglichkeiten auf. Er war ansprechbar, erkannte uns und war zu
einigen Worten fähig. Es war sehr gut, konnte aber die Krankheit
nicht aufhalten. Er wurde schon bald entlassen. Als ich ihn abholte, stieg er alleine ins Auto.
Nach ein paar Tagen zu Hause ging es aber erst einmal für wenige Wochen in ein Altenheim rund fünf Kilometer entfernt. Mutter
musste unbedingt einmal zur Ruhe kommen, obwohl sie dann doch jeden
Tag per Bus und Fußweg dort war. Vater war zum Teil im Bett und im
Stuhl angegurtet „damit er nicht rausfällt“. Sein ganzes
Gedächtnis hatte er nicht verloren, auch wenn er inzwischen kaum
noch klare Worte sprechen konnte. Wenn wir kamen, lächelte er „über
beide Ohren“. Er wusste, dass jetzt „seine Leute“ da waren.
Natürlich holten wir ihn schnellstmöglich daraus. Nach Hause, in
seine vertraute Umgebung. So, wie er sich freute, als er da war! Er
wusste wohl, „zu Hause“ zu sein. Das war für alle schön.
Für einige Zeit
noch „da“
Zu Hause saß er
aber mehr oder weniger nur noch an „seinem Platz“ neben dem
Wohnzimmertisch, guckte ein bisschen in den Fernseher, die Zeitung, die er früher Tag für Tag beflissen gelesen hatte, interessierte ihn nicht mehr. Unsere Namen
konnte er nicht mehr sagen, aber er erkannte uns wohl bis zuletzt. Er war weiterhin
unruhig mit seinen Händen, lief aber nicht herum und war stets ganz
friedvoll. Ich war nahezu jeden Abend nach der Arbeit da, um Mutter
zu helfen, wenn sie ihn zum Bettgang aus- und den Schlafanzug anzog.
Ich hielt ihn dabei sanft von hinten über die Brust fest, damit er
nicht umfiel. Weil er davor Angst zu haben schien, redete ich mich
ihm „Papa, keine Sorge ich halte dich fest.“ Dann blieb er stehen
und wartete, bis das Umziehen fertig war und wir ihn ins Bett
brachten. Da war wohl noch so einiges bei ihm gespeichert.
Vater kam in dieser
Zeit nicht mehr ins Krankenhaus und auch nichts ins Pflegeheim. Er
war „bei uns“. Es gab keine besonderen Vorkommnisse, der
Hausarzt kam nur regelmäßig zum Gucken. Eduard wird aber immer
hinfälliger und irgendwann komplett bettlägerig. Es ereilt ihn das,
was nach wie vor in vielen Fällen ein Problem ist, eine
Lungenentzündung. Er atmete schneller, griff nachts immer wieder
noch zu den Händen meiner Mutter und hielt sie fest. Auch in der
Nacht, als es passierte, wie Mutter sagte. Er hörte auf zu atmen. Der Arzt konnte nur
noch den Tod feststellen.
Mich ereilte die
Todesnachricht am frühen Vormittag auf der Arbeit. Es war kein
Thema, dass ich direkt nach Hause konnte. „Sanft entschlafen“
sagt man, ich drückte noch die Hand meines Vaters. Danke für alles
und die wunderschöne Kindheit - alles umwoben von tiefgehender Trauer.
Hinweis: Am
21. September ist Alzheimer-Tag. Je nach Quelle werden für
Deutschland zwischen etwa 1,2 und 1,5 Millionen Erkrankte gemeldet.
Diese Erkrankung macht danach wohl den größten Teil der
Demenz.-Erkrankungen aus. Demenz steht für nachlassenden Verstand
oder nicht mehr richtigen Verstand. Früher nutzte man bei alten
Menschen den Begriff „Verkalkung“. Die Bezeichnung Alzheimer
(Morbus Alzheimer) rührt vom Namen des deutschen Psychiaters
Alzheimer her, der bei Patienten Veränderungen, Ablagerungen, im
Gehirn erkannte. Vereinfacht ausgedrückt, funktioniert dadurch nicht
mehr die notwendige Signalübertragung zwischen den Nervenzellen und -bahnen. Das
Gehirn verliert unter anderem die Fähigkeit, Wichtiges zu verbinden.
Eventuell sind manche Hirnregionen weniger belastet. Musik, Melodien
sind wie beim Vater zum Teil noch lange „da“, im Kopf.
Ob diese
Ablagerungen alleine Schuld sind, ist ungewiss. Es gibt auch
Untersuchungen, nach denen Menschen mit diesen Eiweiß- oder
ähnlichen Ablagerungen nach wie vor geistig fit sind. Andererseits
scheint es auch keine Rolle zu spielen, ob man bis vorm endgültigem
Ausbruch der Krankheit geistig rege und fit war. Im Prinzip kann
jeder betroffen werden. Es gibt in der Literatur zahlreiche Hinweise,
auch zu möglichen oder gedachten Ursachen. Da sie nicht endlich geklärt sind, kann man
nur von Vermutungen ausgehen. Schließlich sind Menschen mit völlig
verschiedenen Lebensläufen hinsichtlich Ernährung, Aufwachsen,
Bildung, sportlichen Aktivitäten, niedriger und hoher
Geistesaktivitäten, übergewichtige und schlanke Menschen betroffen.
Zum Teil beginnt die Krankheit heute auch schon Ende der 40er-Lebensjahre und schreitet voran. Mit zunehmendem Alter scheint
Alzheimer vermehrt aufzutreten. Aber, zum Glück, sind längst nicht
alle betroffen.
Die genauen Ursachen
und Abläufe sind bis heute nicht richtig bekannt. Das ist auch der
Grund, warum es zurzeit keine Arzneimittel gibt, mit denen die
Krankheit geheilt werden kann. Im Frühstadium werden Medikamente
eingesetzt, die den Verlauf verzögern sollen.
Für die
Wissenschaft und Forschung gibt es diesbezüglich viel Arbeit, die
Zusammenhänge erkennen und verstehen zu können und die richtigen
Ansätze zu finden, die eine Therapie ermöglichen. Die derzeitige
Situation ist so, dass weltweit mit einer steigenden Zahl von
Erkrankungen gerechnet wird.
Wie bei einem Koma
ist nach den hiesigen Erfahrungen auch gar nicht bekannt, was in
Sachen Erinnerung, Erkennen, Regungen usw. noch ganz oder in Resten
vorhanden ist, weil sich Betroffene meist nicht mehr oder nicht mehr
richtig artikulieren können.
Betroffene bzw.
deren Angehörige finden mehr auf den Seiten der Deutschen
Alzheimergesellschaft
In vielen Orten gibt
es Vereine oder Arbeitskreise zum Thema.
Hinweis für Redaktionen: Zu Abdruck oder anderer Veröffentlichung des Artikels oder Teilen davon bitte erst bei uns anfragen (presseweller.de). Gerne stellen wir auch eine gekürzte Zusammenfassung oder ergänzende Texte zur Verfügung.